Das Projekt
Der Kanton Uri befindet sich in intensivem und schnellem Wandel. Das sehen wir etwa in den tiefgreifenden touristischen Entwicklungen, intensiven Werbeinitiativen für Urner KMU oder in Form des Urner Instituts «Kulturen der Alpen», der ersten universitären Institution im Kanton. Viele andere Bereiche sind ebenso vom Wandel betroffen, er ist jedoch nicht immer so deutlich erkennbar wie beispielsweise anhand des Dorfbildes von Andermatt oder dem neuen Altdorfer Bahnhof.
Mit dem Projekt «Uri im Wandel – Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog», dem sogenannten Dialogprojekt, tragen wir besonders den Wandlungsprozessen Rechnung, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Wir schaffen ein Forum, in dem sich Wissenschaft und Bevölkerung über diese Dynamiken austauschen und sie in Bezug zu früheren Entwicklungen setzen können. Wir erörtern, wie sich die Veränderungen auf den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohnern auswirken oder auch, wie Wandel und seine Beschleunigung von den im Kanton lebenden Menschen wahrgenommen und genutzt wird. In Austausch mit der Bevölkerung tritt das Dialogprojekt insbesondere an öffentlichen Veranstaltungen, wo das Projektteam seine Recherchen- und Forschungsergebnisse im Gespräch mit Podiumsgästen und dem Publikum diskutiert und die Anwesenden in verschiedenen Formen zum Erzählen von Erlebnissen und Erfahrungen animiert.
Das Projektteam

Rahel Wunderli (1978) ist in Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen, hat in Basel Geschichte und Ökologie studiert und promoviert, später an der Universität Bern eine Post-Doc Arbeit geschrieben. Heute lebt sie sowohl in Möriken (AG) als auch auf dem Belpberg (BE). Uri ist seit über 20 Jahren ein wichtiger Bezugspunkt für sie. Angefangen hat der Kontakt als Alphirtin im Etzlital, später sind Arbeiten zur Geschichte der Urschner Landwirtschaft und der Korporation Uri hinzugekommen. Dank verschiedener Forschungsprojekte am Institut «Kulturen der Alpen» lernt sie ständig neue Aspekte dieses Kantons und seiner faszinierenden Geschichte kennen.
«Was ist echter, fruchtbarer Dialog? Wie können wir soviele Stimmen wie möglich in die Diskussion einbeziehen? Auch an solchen Fragen arbeiten wir in diesem Projekt.»

Chiara Zgraggen (1997) ist im Kanton Uri aufgewachsen und hat ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zur Medizinischen Praxisassistentin gestartet. Später diente sie als Wachtmeister in der Schweizer Armee und arbeitete als Journalistin und Produzentin bei der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben (CH Media), bevor sie sich der Wissenschaft zuwandte. Seit 2022 studiert sie Geschichte und Kunstgeschichte an den Universitäten Luzern und Zürich. Im Sommer 2025 hat sie ihren Bachelorabschluss mit einer Arbeit zur Pilgerreise als Strategie des politischen Aufstiegs anhand des Urner Landammanns Josue von Beroldingen (1495-1563) untersucht. Auch in weiteren Arbeiten hat sie sich mit der Urner Geschichte auseinandergesetzt.
«Wandel ist nichts Neues. Wie die Urnerinnen und Urner mit verschiedenen Aspekten davon umgehen, fasziniert mich - sowohl in zeitgenössischer, als auch in historischer Perspektive.»
Die Begleitgruppe

Nathalie Barengo (1974) ist in Luzern und Zürich aufgewachsen. 2002 ist sie zu ihren Wurzeln im Kanton Uri zurückgekehrt und wohnt heute in Altdorf. Sie hat Forstwirtschaft an der ETH Zürich studiert und arbeitet als Kreisforstmeisterin im Zürcher Weinland. Als ehemalige Korporations- und Bürgerrätin und mit zwei Kantonen im Herzen hat sie gelernt, Brücken zu schlagen zwischen Landschaft, Alltag, Kulturen und Lebensräumen.
«Kulturen sind eng verknüpft mit Landschaft, Landwirtschaft und Wald. Wie sich Wandel gestaltet, wie Generationen damit umgehen – und wie Alt und Jung sich finden – gehört zu unserem gemeinsamen Weg durch die Zeit.»

Thomas Brunner (1967) ist im Kanton Zug aufgewachsen und hat in Zürich Geschichte und Kunstgeschichte studiert und promoviert. Er hat im Kanton Uri das Kunstdenkmälerinventar «Oberen Reusstals und Ursern» bearbeitet. Nach Tätigkeiten in der Denkmalpflege in den Kantonen Zug und Schwyz ist er seit 2018 Denkmalpfleger in Uri. Er wohnt mit seiner Familie seit 1999 in Altdorf.
«Uri besitzt eine reiche Kulturgeschichte, die vom Austausch und Wandel geprägt ist. Die Beschäftigung mit dem Bewusstsein um diese ständigen Veränderungen im vermeintlich statischen Gotthardgebiet reizt mich.»
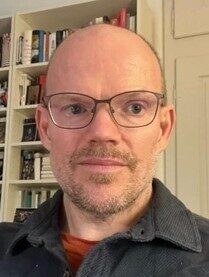
Daniel Kauz (1971): Seit 2004 wohne ich mit meiner Frau in Gurtnellen, im oberen Reusstal, zuvor lebten wir in Zürich. In den Kanton Uri zu ziehen, war für uns ein Experiment. Wir führen es immer noch gerne fort. Als Archivar und Records Manager arbeite ich hauptsächlich auswärts. Land wie auch Stadt, gebirgige wie urbane Räume sind Alltag. In dem Masse wie mich die kargen, stotzigen Landschaften faszinieren, die ich gerne durchwandere, interessieren mich als Historiker verschiedene Lebenswelten, vergangene wie gegenwärtige mit ihren Verflechtungen. In den mir unbekannten Kanton Uri zu kommen, ermöglichte mir neue solche kennenzulernen.
«Den Kanton Uri, der jenseits von Verkehrs- und Freizeitraum kaum im Rampenlicht steht, fassbar zu machen, indem Themen aktuellen Wandels aufgegriffen werden und unterschiedliche Menschen ihre Erfahrungen teilen, dies sucht und bietet das Dialogprojekt Uri. Genau diese Möglichkeit fasziniert mich.»
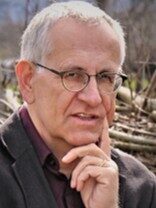
Josef Schuler (1954) ist in Bürglen aufgewachsen und lebt seit 1974 in Isenthal, wo er als Primarlehrer arbeitete. Er studierte Erwachsenenbildung (AEB), Gruppenpädagogik (TZI) und Kulturmanagement (Uni Bern) und leitete zwei Jahrzehnte das Amt für Kultur, Jugend- und Sportförderung in Uri. In Isenthal engagierte er sich im Schul- und Gemeinderat, im Tourismus, der Kulturkommission und gründete den Verein "Zukunft Isenthal". Er initiierte zahlreiche Kultur- und Dorferneuerungsprojekte in Uri. Ausgewählte Publikationen von ihm: «Isenthal – Dorferneuerung als Generationenwerk» (1999), «Isenthal – Geschichte und Gegenwart» (Mitautor, 2021). Zudem schreibt er als Lokalberichterstatter zu Berggebiets- und Kulturthemen in den Urner Zeitungen.
«Uri und das Berggebiet sind zu meiner politischen Aufgabe geworden. Entwicklung und Freiheit wächst, wo man die Realität von bedingenden inneren und äusseren Grenzen akzeptiert.»

Frieda Steffen-Regli (1959) ist eidg. diplomierte Bäuerin, ehemalige Lehrerin für Hauswirtschaft und ehemalige Kantonsrätin. Als Urnerin ist sie im Luzernischen aufgewachsen und wohnt seit Langem in Andermatt.
«Was mache ich alleine?» fragte ich einen Weisen. «Suche einen Zweiten», antwortete dieser. «Und dann?» Findet einen Dritten.
Mir ist die Vertretung der Regionen, Generationen und Berufsgattungen und so die verschiedenen Sichtweisen auf Uri sehr wichtig. Es ist interessant, dass die öffentlichen Anlässe des Dialogprojekts recht viele Teilnehmende anziehen. Die sehr heterogene Zusammensetzung der Begleitgruppe fordert mich immer wieder heraus, die eigene Meinung zu überdenken oder klar kundzutun und zu verteidigen. Besonders wichtige Aspekte von Wandel sind für mich der Wertewandel und der Strukturwandel im Allgemeinen, in der Landwirtschaft und im Gewerbe. Dieser Wandel verändert Dörfer, Dorfbilder und Gegenden.
Alleine kann kaum jemand etwas bewegen, wenn wir einen Zweiten suchen, können wir einen Dritten finden. Das ist die Hauptmotivation, in der Begleitgruppe dabei zu sein.

Rebekka Wyler (1978) ist in Zürich aufgewachsen und lebt seit 2016 in Erstfeld. Sie hat in Zürich Geschichte und Volkswirtschaft studiert und zu «Schweizer Gewerkschaften und Europa» promoviert. Viele Jahre war sie in verschiedenen privaten und öffentlichen Archiven tätig. Von 2018 bis 2024 war sie Co-Generalsekretärin der SP Schweiz. Nach drei Monaten Alpsommer begann sie im Herbst 2024 als Projektleiterin bei der Firma Provisio AG in Altdorf zu arbeiten. Sie ist seit 2017 Gemeinderätin in Erstfeld und verantwortet dort zurzeit das Ressort Finanzen. Als Präsidentin der Energiestadtkommission Erstfeld setzt sie sich auch mit Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes auseinander.
«Ich habe lange in der Stadt gelebt, heute bin ich im Kanton Uri zuhause. Die Arbeit auf der Alp hat mir nochmals andere Aspekte des hiesigen Lebens nahegebracht. Das Dialogprojekt nimmt wichtige Themen des Berggebiets auf und bezieht die Menschen vor Ort mit ein.»



